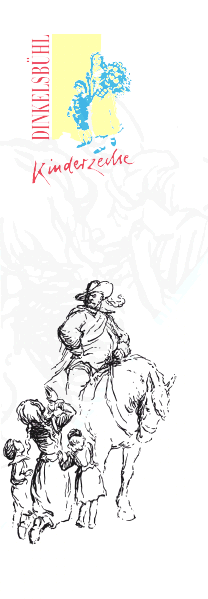
Historie
Historischer Hintergrund der Kinderzeche Dinkelsbühl
Entstehung und Entwicklung
Fällt der Name Kinderzeche, so wird man oft gefragt, was denn „Kinder“ mit „Zechen“ zu tun hätten. Bringt man dann noch ins Spiel, dass die Hauptakteurin des Festspiels eine „Lore“ sei, so hört man nicht selten den Vorwurf Kinderarbeit zu verharmlosen. Dass dies natürlich alles nicht der Fall ist und das die oben gestellten Fragen in den letzten Jahrzehnten immer weniger wurden, das ist dem Engagement vieler ehrenamtlicher Menschen zu verdanken, die bereits seit Generationen am Erhalt dieses insgesamt schon über 400 Jahre alten Brauchtums mitwirken. Die Kinderzeche in ihrer heutigen Form gründet sich auf zwei Säulen, die eine ist das Schulfest, das erstmals nachweisbar im Jahr 1629 ist. Die zweite Säule ist die Historisierung dieses Schulfestes, die 1848 begonnen, mit der Uraufführung des Festspiels am 12.07.1897 ihren Höhepunkt findet. Da sich diese im Jahr 2022 zum 125. Mal jährt begeht die Kinderzechgemeinde dieses Jubiläum gemeinsam und in froher Erwartung, haben doch die letzten zwei Jahre des pandemiebedingten Ausfalls tiefe emotionale Löcher in die Herzen vieler Dinkelsbühler und Dinkelsbühlerinnen gerissen.
Beginnen wir also mit dem historischen Ursprung des Kinder- und Heimatfestes „Die Kinderzeche“ in Dinkelsbühl, die sich seit 2016 deutsches Immaterielles Kulturerbe nennen darf. Der erste archivalische Nachweis findet sich in den Rechnungsbüchern der katholischen Stipendiatenpflege, die 1629 einen Gulden zum Zechen der Schüler ausweist. Noch in den 1980er Jahren war man sogar vom Jahr 1635 ausgegangen, da hier ein Nachweis von drei gestifteten Gulden für die Schulzeche gefunden worden war. Ein Umstand der hier auf jeden Fall Einzug finden muss, da beide Jahre mitten um 30-jährigen Krieg waren und wohl zu dem Umstand geführt haben, dass die Errettungssage, auf die in späteren Beiträgen noch eingegangen wird, sich auch diese Zeit zum Thema nimmt. Allerdings bietet auch genau das Jahr 1635 und das Stattfinden einer Schulzeche den Anlass zur Vermutung, dass diese Tradition schon deutlich älter ist als 1635. Dieses Jahr markierte in Dinkelsbühl eines des schlimmsten sog. Pestjahre überhaupt. „Sogenannt“ deswegen weil Pest in der Frühen Neuzeit ein Überbegriff für eine schlimme epidemische Krankheit war. Im Dinkelsbühler Fall raffte diese wohl 2/3 der Gesamtbevölkerung dahin. Also eine Situation, in der die Durchführung einer solchen Tradition schon lange in der Bevölkerung verwurzelt sein musste. Vermutungsweise datiert die Schulzeche zurück ins Jahr 1475. Der ehemalige Stadtarchivar Gerfrid Arnold will hier ein Umhersingen von Stipendiaten als Ursprung ausgemacht haben. Objektiv betrachtet kann hier allerdings keine direkte Traditionslinie gezogen werden. Schaut man in andere Reichsstädte des schwäbischen Reichskreises so kommt man eher zu dem Schluss, dass die Schulzeche in einer Linie mit den klassischen Rutenfesten steht. Diese sind vor allem im 16. Jahrhundert dokumentiert, was natürlich nicht ausschließt, dass die Feste insgesamt deutlich älter sind.
Die katholische Schulzeche stammt also nachgewiesener Maßen spätestens aus dem Jahr 1629. Evangelische Schüler waren in Dinkelsbühl von Stipendien der katholischen Lateinschule ausgeschlossen. Eine protestantische Lateinschule existierte zu diesem Zeitpunkt nicht. Hier brachte die paritätische Stadtverfassung in Bezug auf die Entwicklung des Festes ein entscheidendes Element. Durch das Zugeständnis der Beteiligung der Protestanten am sog. „Stadtregiment“ also der Stadtregierung in Folge des Westfälischen Friedens 1648, erstritt sich die evangelische Gemeinde bis 1653 eine eigene Lateinschule und so fand im Jahr 1654 die erste „Kinderzeche“ statt. In Erinnerung an die Mitteilung der Erlangung der Parität am 14.Mai. Schon ein Jahr später wurde der Termin, auf den letztlich bis heute gültigen Zeitraum Mitte/Ende Juli, gelegt. Grund waren die „Schulvisitationen“, die eine Art Jahresprüfung darstellten. Somit fand im Abstand von nur einer Woche die katholische Schulzeche und die evangelische Kinderzeche statt. Vor diesem Hintergrund ist die Festwoche bis heute zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt fanden die Feste jedoch noch nicht in der Stadt statt. Gefeiert, „gezecht“, wurde in den Wirtshäusern der Umgebung, vor allem Seidelsdorf. Erstmalig auf dem Schießvasen fand das Fest in den Jahre 1662-64 im Rahmen eines Preisschießens statt. Dieser Ort setzte sich aber erstmal nicht durch und so wurden die „Zechen“ weiter in Seidelsdorf oder sogar den Schulen gefeiert. Den Schritt zum Bürgerfest markiert laut Gerfrid Arnold, die Zeit um das Jahr 1700. Ab dann wird der Schießvasen zum Austragungsort, außerdem entwickelt sich die Errettungssage, dass die Kinder der Stadt im Jahr 1632 die schwedischen Belagerer, im Endeffekt erfolgreich, um Gnade gebeten hätten. Den nächsten Entwicklungsschritt vollzog die evangelische Kinderzeche anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Westfälischen Friedens. Hier wird von großen Feierlichkeiten berichtet, in deren Rahmen auch die Zeche abgehalten wird. Um 1780 berichtet Christoph von Schmid von evangelischen Knaben, die sich zu Kompanien zusammenfinden und die vom besten Schüler angeführt werden, der ein kleiner Obrist ist. Dieser Zug fände nach dem Gottesdienst in Richtung des Schießvasen statt. Der Dinkelsbühler Stadtchronist und Magistratsrat Matthäus Metzger berichtet 1803 diesen Umstand ebenfalls, wobei hier schon Zuschauer, sowohl einheimische, sowie fremde, Teil des Spektakels seien. Ein ebenfalls bemerkenswerter Zustand, bedenkt man doch, dass in diesem Jahr Dinkelsbühl seinen Status als Reichsstadt verliert, allerdings wohl keiner, der den Dinkelsbühlern Ihre „Kinderzeche“ madig machen sollte. Auch die Bajuvarisierung tut diesem Brauch keinen Abbruch und so feiert man erstmalig 1812 die Kidnerzeche mit Evangelen und Katholiken zusammen. Zu diesem Zeitpunkt war das Fest schon lange kein Lateinschulfest mehr. Es nahmen schon seit über 100 Jahren auch die Schüler der „deutschen“ (Grund-) Schule teil. Als Dinkelsbühl im Jahr 1818 durch das bayerische Gemeindeedikt gewisse Rechte zurückerhält schlägt sich das auch bei der Kinderzeche nieder, so wird erstmals eine, bis heute stattfindene, Kinderzechmesse auf dem Schießvasen abgehalten. Diese entwickelte sich zum heutigen Volksfest auf dem Schießvasen, das immer parallel zur Kinderzeche stattfindet und auch gleichzeitig als eine Art Kirchweih fungiert. Leider hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch, gerade des Dinkelsbühler Umlandes, das „Zur Kinderzechegehen“, als Synonym zum Besuch des Bierzeltes bzw. der Fahrgeschäfte auf dem Schießvasen entwickelt. Dem soll hiermit etwas entgegengewirkt werden, das sich heute bei der Kinderzeche um das historisierte Kinder- und Heimatfest handelt.Diese Historisierung beginnt, wie bereits erwähnt, im Jahr 1848. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Westfälischen Friedens erhalten die Knaben schwedische Uniformen und Waffen des 30-jährigen Krieges. Es wird ein Zug durch die Stadt veranstaltet und der „kleine Obrist“ trägt erstmals den von Pfarrer Johann Conrad Unold-Zangmeister verfassten Spruch über die Errettung der Stadt vor. Dieser unterlief noch einige kleinere Änderungen und wird seit 1864 unverändert immer am Ende des Festzuges vom kleinen Obristen vorgetragen. Das Jahr 1868 markiert dann das Gründungsjahr der Knabenkapelle (zu den genaueren Umständen und Vorläufern empfiehlt sich die Lektüre des entsprechenden Buchs von Adolf Lober, genaue Angabe im Literaturverzeichnis). Ein weiterer, bis heute wichtiger und unverzichtbarer Teil des Festablaufs. Ausgehend von dieser Entwicklung wächst das historische Element des Festes immer weiter und so empfiehlt, vermutlich in der Folge der Uraufführung des Meistertrunk in Rothenburg, ein Gutachten den Bürgern der Stadt die Einführung eins Festspiels. Dieses, von Ludwig Stark, geschriebene Stück, feiert am 12.07.1897 Premiere. Seither hat sich die Kinderzeche in ihrer heutigen Form zum Mittelpunkt des Jahres in Dinkelsbühl entwickelt. Der Text des Festspiels blieb bisher auch weitestgehend unangetastet und so bekommt man als Zuschauer ein authentisches Gefühl der Zeit des 30-jährigen Krieges. Wer zur Entwicklung Genaueres wissen möchte, dem sei die Festschrift „125-Jahre Festspielt der Kinderzeche“ empfohlen.
© 2026 Historisches Festspiel "Die Kinderzeche" www.kinderzeche.de





